Nun ist es endlich so weit, die Evaluierungs- und Installationsprozesse sind abgeschlossen und das System soll nach Willen der Verantwortlichen, bereits morgen an die Mitarbeiter übergeben werden und den Betrieb aufnehmen.
Aber mal Hand aufs Herz…was haben wir denn jetzt zur Verfügung?
Wir können eine Oberfläche aufrufen, je nach aufgesetztem System gibt es dann bereits ein Grund-Template über das man verschiedene Funktionen ausführen kann. Das Herzstück eines PIMs sind sicherlich die Produkte samt ihrer Produktdaten.
Aber wo kommen die her und wo kann man sich die dann anschauen?
Verschaffen wir uns vorab einen Überblick, denn es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie Unternehmen mit Produktdaten umgehen.
Die IT-Infrastruktur
Wenn wir es an dieser Stelle einmal ganz, ganz simpel halten wollen, dann gibt es nur drei wesentliche Elemente:
ERP-System
Hier entstehen i.d.R. die Artikel. Es werden Lieferanten, EAN / GTIN, Abmessungen, Gewichte, Gefahrenkennzeichen und natürlich Preise angelegt bis daraus letztendlich die finale Artikelnummer erzeugt wird. Diese stellt dann den unique key dar, der im kompletten Lebenszyklus zur Kommunikation verwendet wird.
PIM-System
Im PIM erfolgt die Datenanreicherung, d.h. Assets, Beschreibungen, Attribute und Kanalzuweisungen werden hier hinzugefügt.
Auch die qualitative Prüfung durch den sogenannten „Golden Record“ und die anschließende Kanalfreigabe, erfolgen hier.
Webshop / Marktplatz / Katalog / POS
Hier hat der Kunde letztendlich Zugriff auf das Produkt.

Der Ursprung von Artikeln / Produkten
Hier gibt es in der Praxis nur zwei Methoden:
- Der Artikel entsteht im ERP-System und wird ans PIM weitergeleitet
- Der Artikel entsteht im PIM und wird ans ERP zurückgeführt
Dabei entstehen 95% der Artikel im ERP und nur ein sehr geringer Anteil wird zuerst im PIM erzeugt. Dies macht in der Regel auch absolut Sinn, denn wenn man in Betracht zieht, dass viele Artikel erst produziert werden müssen oder auch Muster durch Freigabe-Stufen der Qualitätssicherung laufen müssen und erst unter Projektnummern geführt werden, dann haben wir viele Artikel ohne finale Artikelnummer und die würden im PIM nur Platz verbrauchen und die Übersichtlichkeit beeinträchtigen.
Ich beziehe in diesen Projekten auch klar die Position, ERP first und nur die Artikel, die auch tatsächlich in den Verkauf gehen sollen, werden ins PIM weitergeleitet. Wir haben also bereits hier das erste Quality Gate zu passieren.
Altdaten-Übernahme / Revision
Eines wollen wir zu 100% vermeiden, den ganzen alten Mist 1:1 in unser neues PIM zu übernehmen. Schließlich hatte es einen Grund, warum ein PIM eingeführt wurde und der ist meistens in unzufriedenstellender Datenqualität und Dateninkonsistenz begründet.
Im Vorfeld haben sich somit Projektleiter, Fachbereichsleiter (Einkauf) und Marketing darauf zu verständigen, welche Artikel übernommen werden müssen und welche Qualitätskriterien anzusetzen sind, bei der Bewertung des Artikelstamms.
Der Austausch mit anderen Projektleitern auf Messen u.ä. Veranstaltungen zeigt, dass hier oft der Mut fehlt, rigoros alte Zöpfe abzuschneiden und Daten lieber neu erstellen als aufwändig zu optimieren.
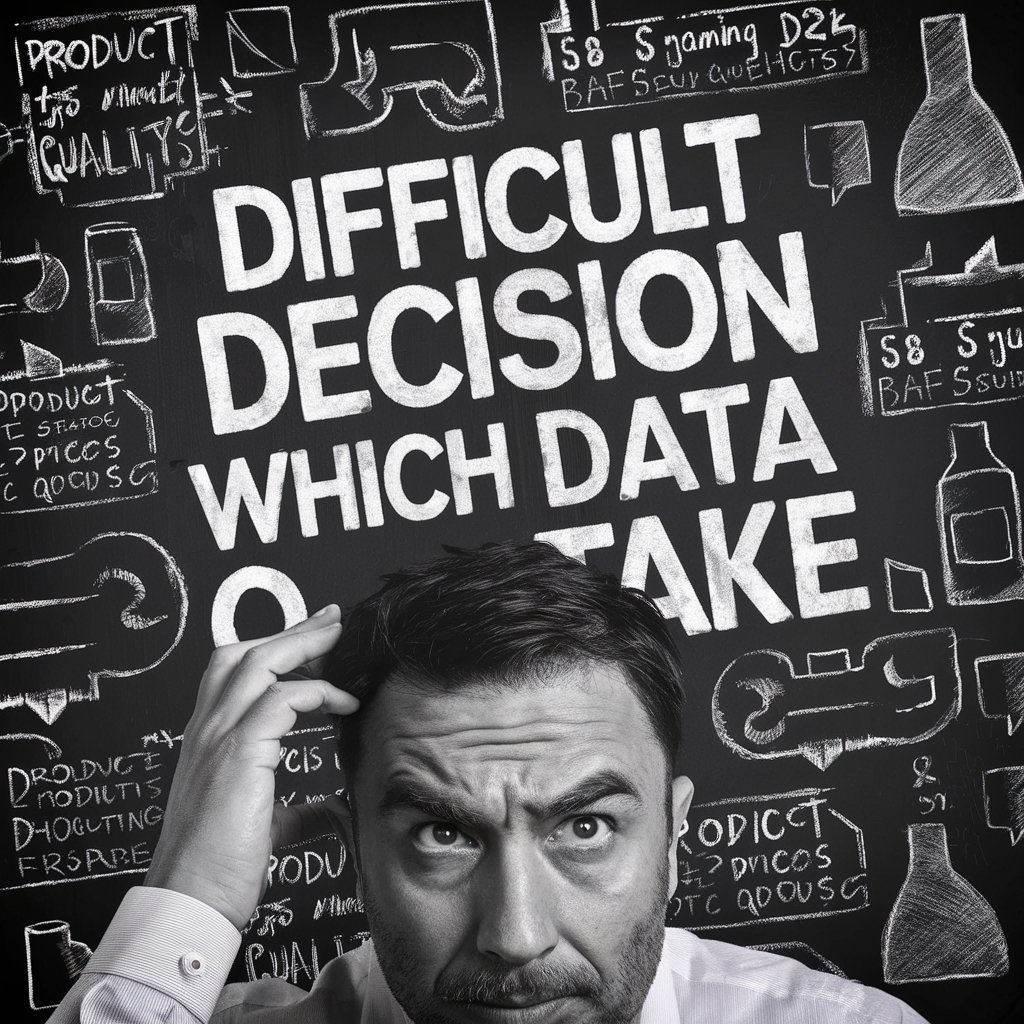
Im Zeitalter von KI ist es glücklicherweise möglich, schnell schlechte oder fehlerhafte Bilder zu erkennen, zu taggen oder sogar als Referenz vom Artikel zu entfernen.
Die PIM-Module ermöglichen es, Massenimporte von Texten und Attributen vorzunehmen. So kann man bei Markenprodukten entsprechende Exporte beim Hersteller anfordern, diese sichten und importieren.
Bei Eigenmarken können entsprechende Werbetexter beauftragt werden oder die Implementierung des PIMs ermöglicht es, entsprechende KI-Module zu bemühen und Texte zu erzeugen. Hier können NLP-Modelle zum Einsatz kommen oder einfache Prompt basierte Engines wie ChatGPT.
Aber Moment einmal! Woher weiß das PIM denn, welche Daten es am Artikel anzeigen soll?
Der Klassifizierungsbaum
Jeder der mit Artikeln und Artikeldaten zu tun hat, kennt Klassifizierungen in irgendeiner Art und Weise. Sei es ERP seitig eine Warengruppe oder von Herstellern bereitgestellte Klassifikationen wie BMEcat, eClass, ETIM oder ProfiClass.
Gehen wir zunächst der Frage nach, wofür ist eine Klassifizierung notwendig oder zuständig, welche gibt es überhaupt, welche passt zu meinem Anwendungsfall oder kann ich mir nicht einfach selbst eine bauen?
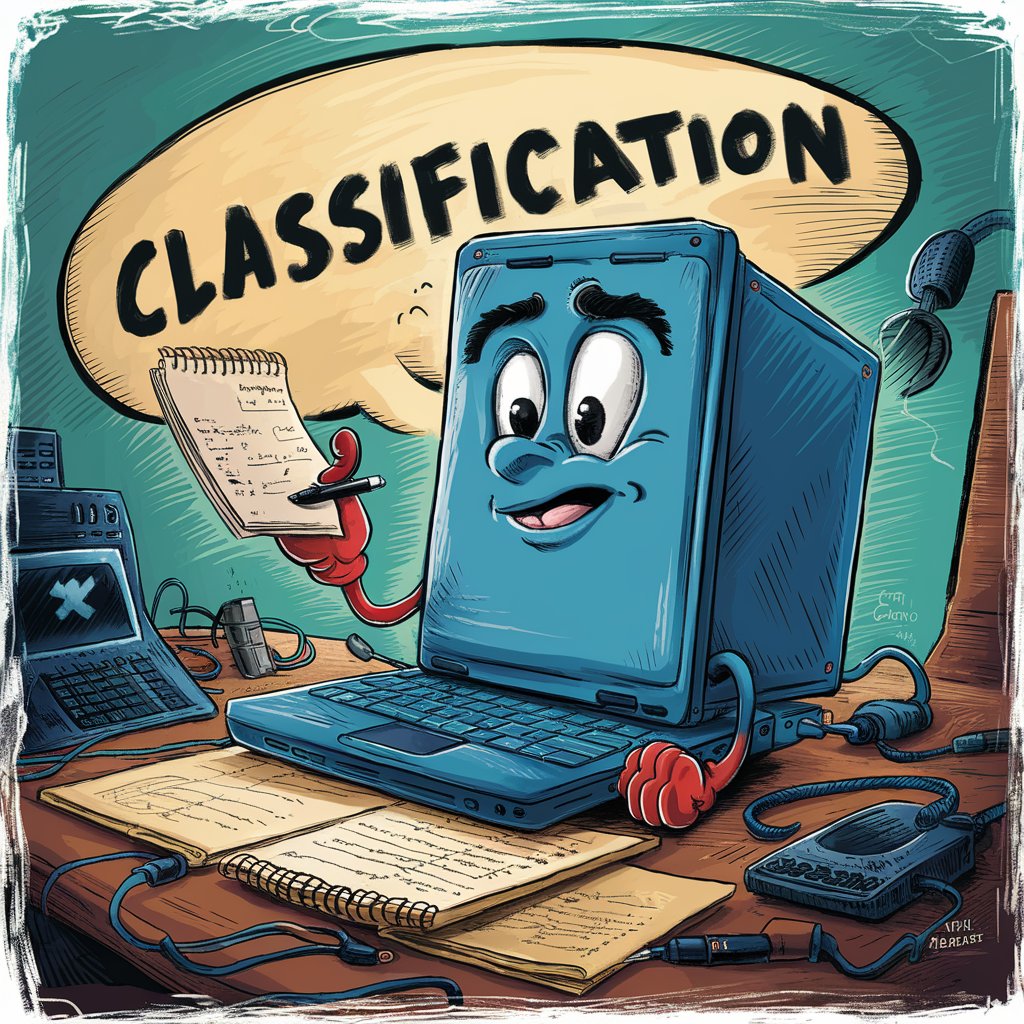
Versuchen wir erstmal den Begriff zu definieren.
Die PIM-Klassifizierung ist die DNA unserer Produktdaten. Über eine Baumstruktur werden hierarchisch, Datenrelationen im Top-Down-Ansatz vererbt. Eine Klassifikation hat die Funktion, ein einheitliches Muster zu schaffen, um Produktdaten zu strukturieren, leichter zu administrieren und für Konsistenz über das gesamte Sortiment und alle Verkaufskanäle zu sorgen.
Die ermöglicht den Usern, Artikeln ein einheitliches und vollständiges Erscheinungsbild in den Verkaufskanälen zu geben. Die PIM-Klassifikation bezieht sich somit auf die Strukturierung und Zuordnung von Produktdaten in einem Product Information Management (PIM)-System. Dies umfasst die Kategorisierung von Produkten in Klassifikationssystemen wie ETIM, ECLASS oder anderen branchenspezifischen Standards, sowie die Zuweisung von Attributen und Beziehungen. Die Hauptaufgabe eines PIM-Systems in Bezug auf die Klassifikation besteht darin, eine Benutzeroberfläche bereitzustellen, die es Benutzern ermöglicht, Produkte effizient zu klassifizieren und mit Eigenschaften zu versehen.
Das heißt, wir benötigen eine Baumstruktur, die unser Sortiment oder auch mehrere Sortimente widerspiegelt und je Ebene dieses Klassifizierungsbaums sind Attribute und Referenzen verknüpft.
Welche Klassifizierungsstandards gibt es?
Abhängig davon in welcher Branche das Unternehmen tätig ist und wie weit das eigene Sortiment diversifiziert ist, kann die Verwendung einer Standard-Klassifizierung bereits ausreichend sein.
Es folgt eine Übersicht über fünf gängige Klassifizierungsstandards, die in verschiedenen Branchen weit verbreitet sind:
eCl@ss: eCl@ss ist ein branchenübergreifendes Klassifikationsschema, das hauptsächlich in der Fertigungsindustrie verwendet wird. Es bietet eine standardisierte Struktur zur Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen. eCl@ss umfasst verschiedene Kategorien und Merkmale, die es ermöglichen, Produkte und Dienstleistungen eindeutig zu identifizieren und zu beschreiben. Es wird oft in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in anderen Bereichen eingesetzt.
ETIM (Elektrotechnisches Informationsmodell): ETIM ist ein internationaler Standard, der speziell für die Elektro- und Elektronikbranche entwickelt wurde. Es bietet eine einheitliche Struktur zur Klassifizierung von Produkten und Merkmalen in diesem Sektor. ETIM ermöglicht eine präzise Beschreibung elektrischer Produkte und unterstützt den Austausch von Produktinformationen zwischen verschiedenen Partnern in der Lieferkette.
BMECat (Beratungsgremium Materialstamm elektronischer Kataloge): BMECat ist ein Standard für den elektronischen Datenaustausch von Produktkatalogen, der häufig im E-Commerce und in der Beschaffung eingesetzt wird. Er ermöglicht es Lieferanten, ihre Produktdaten in einem einheitlichen Format zu strukturieren und an Käufer zu übermitteln. BMECat umfasst verschiedene Attribute und Klassifizierungskriterien, um eine genaue Beschreibung der Produkte sicherzustellen.
UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code): UNSPSC ist ein globaler Standard zur Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen. Er wurde von den Vereinten Nationen entwickelt und dient dazu, einheitliche Kategorien für den Handel und die Beschaffung zu etablieren. UNSPSC umfasst eine breite Palette von Produktkategorien und -merkmalen und wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bauwesen und mehr.
ISO 8000: ISO 8000 ist ein internationaler Standard für die Datenqualität, der sich speziell auf die Definition und Messung von Datenqualität konzentriert. Obwohl es nicht speziell für die Produktklassifizierung entwickelt wurde, spielt es eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Genauigkeit und Konsistenz von Produktinformationen in verschiedenen Systemen und Prozessen.
Diese Standards bieten eine strukturierte und standardisierte Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen zu klassifizieren, was die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Organisationen verbessert und den Datenaustausch erleichtert. Je nach Branche und Anwendungsfall kann einer dieser Standards besser geeignet sein als andere.
An dieser Stelle sei aber auch angemerkt, je nach Vertriebskanal, in dem Produkte platziert werden sollen, empfiehlt es sich oft, eine Kombination aus einem firmeninternen Klassifikationssystem und einem externen, öffentlich verfügbaren System zu verwenden.
Damit greife ich schon mal der Frage vorweg, ob man nicht auch eine eigene Klassifizierung erstellen und verwenden kann.
Standard-Klassifizierungen trifft man häufig bei Herstellern an, die ihre Produkt- oder Fertigungsdaten distribuieren müssen und dabei sicherstellen wollen, dass alle Empfänger die gleichen Daten bekommen und verwenden. Bei Händlern, die ein sehr breites Sortiment anbieten, reicht eine Klassifizierung eventuell nicht aus. Die meisten PIM-Systeme sind in der Lage, mehrere Klassifikationssysteme parallel vorzuhalten und die Daten dann entsprechend am Artikel zu konsolidieren. Dafür sind dann entsprechende Regelwerke im Onboarding-Prozess notwendig.
Vorteile auf einen Blick:
- Die Nutzung elektronischer Kataloge und virtueller Marktplätze erleichtert die Suche nach Produkten erheblich und beschleunigt den Zugriff darauf.
- Durch Optimierung von Einkaufs-, Lager- und Vertriebsprozessen, Bündelung von Großaufträgen und Portfoliostraffung lassen sich beträchtliche Kosteneinsparungen erzielen.
- Eine gesteigerte Kommunikationseffizienz mit allen Beteiligten fördert eine reibungslose Zusammenarbeit.
- Aktuelle, vollständige und korrekte Produktdaten entlang der gesamten Lieferkette bedeuten eine höhere Qualität, verbesserten Service, weniger Fehler und zufriedenere Kunden.
- Die Implementierung durchgängiger Prozesse, automatisierter Schnittstellen und standardisierter Produktinformationen führt zu einer verbesserten Leistung, einem höheren ROI und verkürzten Markteinführungszeiten.
- Die Nutzung von harmonisierten, sinnvoll aufbereiteten Daten, die mit Kunden und Partnern ausgetauscht werden, verbessert die Grundlage für strategische Entscheidungen.
Die Wahl des richtigen Klassifikationsstandards ist wichtig, aber ebenso entscheidend ist die erfolgreiche Implementierung in das Unternehmen und die Geschäftsprozesse. Es ist ratsam, hierfür die Unterstützung von Fachleuten in Anspruch zu nehmen und geeignete Tools und Systeme einzusetzen. PIM-Berater helfen hier über den gesamten Produktlebenszyklus des Systems weiter.
Im nächsten Schritt schauen wir uns schematisch einmal an, wie man sich an die Erstellung einer eigenen Klassifizierung herantastet.
